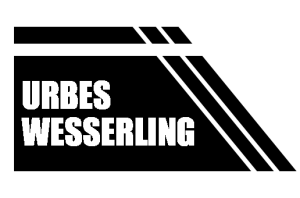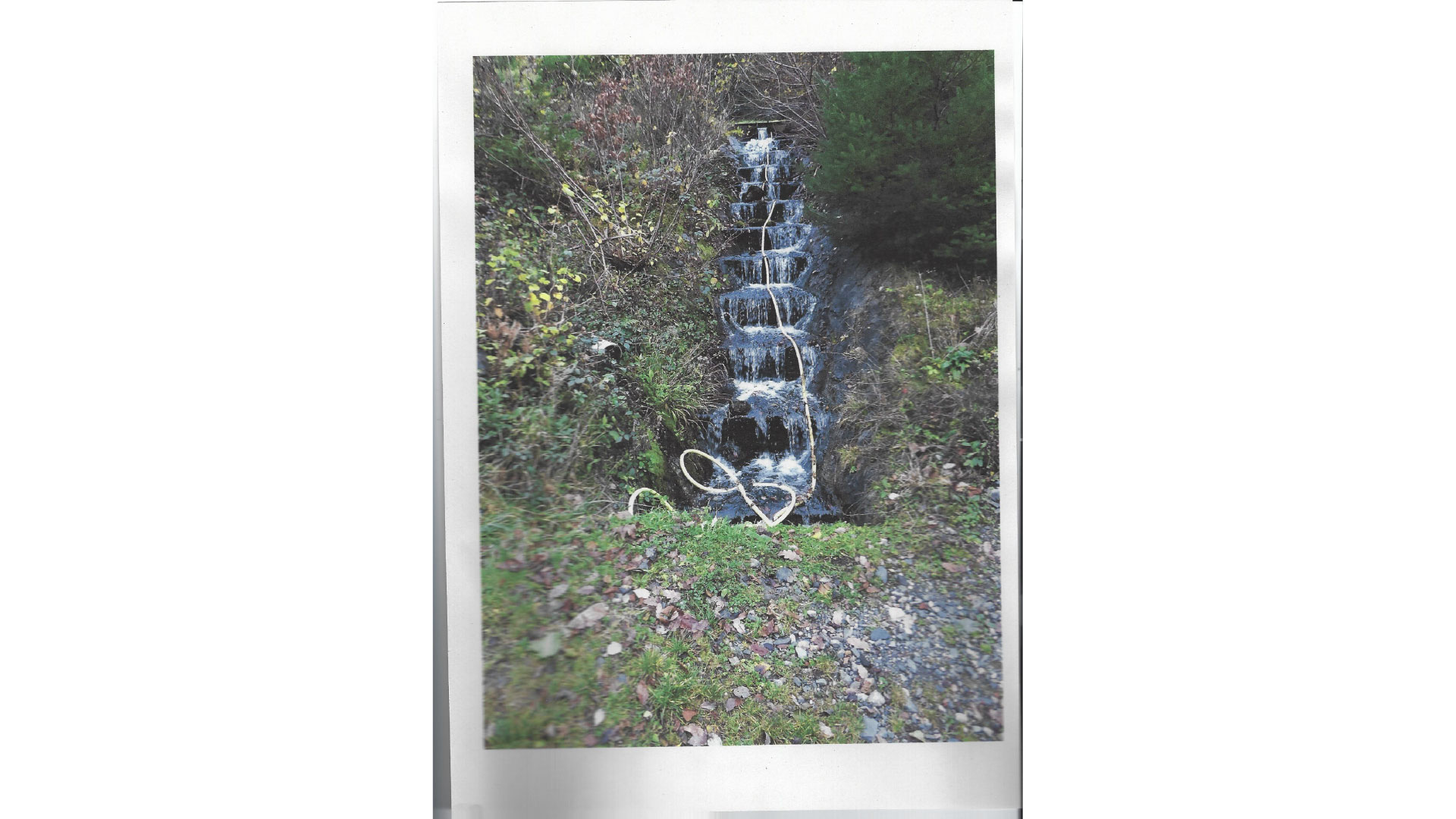ARBEITSORGANISATION ARBEITSKRÄFTE
ORGANISATION UND LEITUNG
Die Leitung insgesamt am Standort unterstand der SS.
Die Wachmannschaft wurde von der Luftwaffe gestellt, wie auch bei dem Geschütz zur Luftabwehr zu sehen ist.
Nach dem 20.Juli 1944, dem Attentat auf Hitler, wurden die Luftwaffensoldaten in die SS übernommen.
Die fachliche Leitung bei der Arbeit wurde von zivilen Arbeitern übernommen, oft von elsässischen Firmen und ihren Angestellten.
Die Leitung der Produktionsarbeit im Tunnel oblag deutschen Facharbeitern, die oft ideologisch ausgerichtet waren. Das heißt, sie waren Nazis und sahen in den Häftlingen Feinde. Die Arbeit an den Motorblöcken selbst, wurde von den sogenannten Arbeitsjuden verrichtet.
Die Organisation innerhalb des Lagers wurde von Funktionshäftlingen übernommen.
Der Lagerälteste namens Köhler war zwar ein Häftling mit grünem Winkel, d.h. er galt als kriminell.
Dieser war jedoch deswegen verurteilt worden, weil er seine Papiere gefälscht hatte um nicht zur Wehrmacht zu müssen.
Er unterstand offenbar dem Lagerältesten des Stammlagers Natzweiler-Struthof.
Die anderen Funktionen im Lager wie Ordnung und Sauberkeit sowie die Nahrungsversorgung und das „Revier“ (Krankenstation), wurde ebenfalls von Häftlingen geleistet.
ARBEITSKRÄFTEBEDARF UND DIE EINZELNEN HÄFTLINGSTRANSPORTE FÜR DAS AUSSENLAGER URBÈS
Der vom Deutschen Reich begonnenen Krieg dauerte im Frühjahr 1944 seit Sep-tember 1939 bereits viereinhalb Jahre.
Zunächst wurde Polen angegriffen und besetzt, dann Dänemark und Norwegen, es folgten die Niederlande, Luxembourg und Belgien, dann Frankreich, verbündet mit Großbritannien.
Auf dem Balkan wurden Jugoslawien und Griechenland angegriffen und besetzt.
Im Juni 1941 wurde die Sowjetunion überfallen, im Dezember des gleichen Jahres den USA der Krieg erklärt. Anfang des Winters 1941 kam der erste Rückschlag vor Moskau mit vielen Toten und Verletzten (zum großen Teil durch Erfrierungen).
Die Besetzungen dieser Länder und die Unterdrückung der Zivilbevölkerung erfor-derten viel Personal. Je härter der Terror der Nazis, desto heftiger wurde der Wider-stand. Ende 1942 ging es ab Stalingrad und dem Kaukasus unter ungeheuren Verlusten an Menschen und Material nur noch rückwärts. Täglich verloren 10.000 deutsche Soldaten ihr Leben. Gleichzeitig wurden Millionen Zivilisten in den besetzten Ländern ermordet. Dies besonders in Polen und den besetzten Gebieten der Sowjetunion.
Je mehr Soldaten gefallen waren, mussten aus den Betrieben die Arbeiter die Lü-cken füllen. Es gab einen gewaltigen Arbeitskräftebedarf, besonders in der Rüstungsindustrie. Diese hatten zudem unter massiven Bombenangriffen zu leiden. Es gab bei den Nazis eine Konkurrenz zwischen denen, die vorrangig Vernichtung und Vertreibung betrieben und denen, die aus der einheimischen Bevölkerung Ar-beitskräfte für die Produktion und Hilfswillige für die Vernichtungslager benötigten. Die Strategie, möglichst viele gefangene Sowjetsoldaten verhungern zu lassen, wurde erst gestoppt, als man feststellte, dass diese auch arbeiten könnten. Bis da-hin waren jedoch bereits ca. 3 Millionen gestorben. Dieses Beispiel kann auch auf andere Gruppen übertragen werden.
Arbeitskräfte aus KZs und Ghettos
Für Urbès wurden in erster Linie die Konzentrationslager im Westen und die Ghet-tos im Osten durchkämmt. Dies galt in erster Linie für Dachau. Diese Häftlinge waren oft jedoch zuvor bereits in anderen KZs oder in Zuchthäusern gewesen. Im Osten galt das für das KZ Majdanek und Auschwitz, sowie die Ghettos in der Ge-gend von Lublin und Rzeszòw. Die Wege der Häftlinge, möglichst von der Verhaftung bis zur Befreiung (oder zum Tod), werden im zweiten Teil dieser Arbeit beschrieben.
DIE ARBEITSORGANISATION
Die Häftlinge wurden in folgende Arbeitskommandos eingeteilt:
- Kommando Bahnhof Wesserling: Laden und Entladen der ankommenden oder des zu verschickenden Materials (Kies, Beton, Steine, Schienen)
- Schloss Wesserling: Bedienen und Bekochen der untergebrachten Offiziere (Trotz Küchendienst dauernder Hunger), Gartenpflege, Aufräumen
- Transport: Von Material zu den Baustellen
- Schienenbaukommando: Verlegen von Schienen für die Feldbahn im Tunnel
- Straßenbau: Neubau von Straßen und Ausbau vorhandener Straßen
- Lager: Lagerdienst, Ordnung schaffen, Essensdienst, Krankenrevier
- Küche
- Kabelbaukommando
- Tunnelausbau
- a) Vorbereitung für den Ausbau
b) Ausräumen von Schotter, Egalisieren des Bodens, Betonieren des Bodens auf 1.600 m Länge, Abflussrinne für Wasser aus dem Berg
c) Holzgerüste für Abdeckung
e) Abdeckung für den Arbeitsbereich
f) Elektroarbeiten - Schmiede
- Sägewerk
- 10.Produktion: Arbeiten an rohen Motorenblöcken
Storkensohn ist eine Jugendbegegnungsstätte etwas abseits von Urbès. Ob dies ein eigenes Kommando war, ist nicht bekannt. Etienne Kotz berichtet, dass dort die Wachmannschaft und die zivilen Arbeiter gegen Typhus geimpft worden sind.
Der Leiter der Begegnungsstätte berichtete von Erzählungen der ansässigen Nachbarn, dass dort Folterungen stattgefunden hätten. Dies lässt sich durch Häftlingsberichte nicht bestätigen. Lagerleiter war der Untersturmführer Brendler. Er war 30 Jahr alt und kam aus Oberschlesien. Er hatte offenbar noch keine KZ-Erfahrung und hatte andere Vorstellungen von der Behandlung der Häftlinge als der Hauptsturmführer Janitsch. Janitsch war für die Produktionsbereiche zuständig. Er war 50 Jahre alt und außerordentlich brutal, kam aus Auschwitz. Brendler untersagte Janitsch den Zugang zum Lager, Janitsch Brendler den Zugang zum Produktionsbereich.
Die Leitung des Ausbaus unterlag dem Kammler-SS-Führungsstab A 10 (Urbès). Die Firmeninteressen wurden vom konzerneigenen Baustab U, mit Sitz in Untertürkheim, wahrgenommen. Stammlager für die Häftlinge war das KZ Natzweiler-Struthof.
TRANSPORTE 1944 NACH URBÈS
ZUGÄNGE
| Transporte | Aus | von | bis | Anzahl |
| 1.Transport | Dachau | 25. März | 09. Oktober | 300 |
| 2. Transport | Dachau | 29. März | 09. Oktober | 201 |
| 3. Transport | Lublin/Majdanek | 06. April | 09. August | 502 |
| 4. Transport | Auschwitz | 06. Mai | 09. August | 550 |
| 5. Transport | Offenburg | Juli | Oktober | 150 |
| 6. Transport | Reichshof/Rzeszòw | 25. August | 30.September | 465 |
| Summe | 2.168 | |||
| Ostarbeiterinnen | Ukraine | ? | Spätestens Anfang Oktober | 150 |
| Kriegsgefangene | Evt. aus Colmar? * | ? | ||
| IMIs aus Colmar | Ca. 300, evt. mehr | Oktober, zum Abbau | Oktober |
*) beim Transport aus Majdanek waren sowjetische Kriegsgefangene
Struktur des 1. Transports von Dachau nach Urbès am 25./26. März 1944
Mit diesem Transport kamen 300 Häftlinge nach Urbès-Wesserling zum Aufbau des Lagers.
Nationen: Die größte Gruppe machten die Italiener aus (mit 101 1/3). Mit Russen (79) und Polen (43) war das über 2/3 der Kolonne. Die nächststärkere Gruppe waren die Franzosen mit 29 Häftlingen. Die anderen verteilten sich auf sieben Nationen.
Der Altersdurchschnitt der verstorbenen Häftlinge lag bei 28,7 Jahre. Dies dürfte nicht sehr vom Gesamtdurchschnitt abweichen.
Erschreckend ist die Sterberate der Italiener mit 42 Toten = 42 %. Insgesamt starben von diesen 300 67 Häftlinge, das sind 22 %. (Im Natzweiler Komplex mit allen 70 Kommandos betrug die Sterberate ca. 40 %, unterschiedlich je nach Kommando.)
Der älteste Häftling, der vom ersten Transport starb, wurde 45 Jahre, der jüngste 18,5 Jahre. In dieser Gruppe gab es 47 verschiedene Berufe, wobei der Schwerpunkt auf Landwirtschaft und bei Arbeitern lag.
| Transporte nach Urbès | ||||||||||
| 1. Transport | 2. | 3. | Struthof | 4 | 5 | 6 | ||||
| Nationalität | 25.3.-9.8. | 29.3.-9.8. | 6.4.-9.8. | NN-Häftl. | 6.5.-9.8. | Jul.-Okt. | ? | 25.8.-30.9. | ||
| aus Dachau | Dachau | Majdanek | März/April | Auschwitz | Stalag OG | UDSSR/Polen? | Rzeszów | |||
| Italien | 101 | 97 | 7 | 166 | 371 | |||||
| UDSSR | 79 | 20 | 257 | 32 | 388 | |||||
| Polen | 43 | 18 | 230 | 5 | 76 | 465 | 837 | |||
| Frankreich | 29 | 13 | 27 | 6 | 75 | |||||
| Jugoslawien | 17 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| Deutsche | 11 | 11 | 2 | 5 | 5 | 34 | ||||
| Griechen | 9 | 2 | 11 | |||||||
| Luxemburger | 4 | 4 | ||||||||
| Rußlanddeutsche | 4 | 4 | ||||||||
| Tschechen | 1 | 13 | 1 | 15 | ||||||
| Niederlande | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Kroatien | 21 | 1 | 22 | |||||||
| Belgien | 1 | 1 | ||||||||
| Albanien | 1 | 1 | ||||||||
| Litauen | 1 | 1 | ||||||||
| Ostarbeiterinnen | 150 | 150 | ||||||||
| 299 | 199 | 501 | 37 | 121 | 166 | 150 | 465 | 1938 | ||
| dazu kommen wenigstens 300 italienische Miliärinternierte, die Herkunft muss noch festgestellt werden. | ||||||||||
DIE ARBEIT
Das Ziel der Nazis, den Krieg zu gewinnen, war von vornherein unrealistisch. Auch alles Sterben an den Fronten, alle Schinderei der KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter, alle Überstunden in der Produktion und auch die „Wunderwaffen“ konnten das Ende nur hinauszögern. Ein Ende, das für die einen die Niederlage, für die anderen die Befreiung bedeutete. Für jeden Tag, an dem die Wehrmacht die Niederlage hinauszögerte, mussten zigtausende in den Vernichtungslagern sterben.
Auch in Urbès wurde ein Unternehmen begonnen, bei dem das angestrebte Ziel nicht erreicht wurde.
Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, musste ein Transport nach dem andern herangekarrt werden. Die vorhandenen Häftlinge reichten nicht, um die Arbeit zu bewältigen.
Es waren Häftlinge, oft schon jahrelang eingesperrt bei geringer Ernährung, die gerade ausreichte, dass das Leben nicht sofort erlosch. Als Beispiel sei hier Ernest Gillen aufgeführt: Als er am 16.4.1942 verhaftet wurde, war er 21 Jahre alt. Wegen seiner Teilnahme im Widerstand kam er in das KZ Hinzert bei Trier, dann in das Gestapo-Gefängnis Wittlich, dann ins KZ Natzweiler- Struthof (Stammlager), dann nach Dachau und von dort nach Urbès. Bei der Befreiung wog er noch 52 kg. So oder noch schlimmer erging es allen.
Mit diesen halbverhungerten und ausgepowerten Menschen sollte Schwerstarbeit geleistet werden. Trotz aller Zwangsmaßnahmen war das unmöglich, so dass immer mehr Häftlinge hermussten.
DIE ARBEIT FING IM BAHNHOF WESSERLING AN
Mit dem Bahnhofskommando. Für den Straßenbau bis zum Tunnel und dem Tunnelausbau wurde pausenlos Material geliefert: Kies, Steine, Zement usw. Und das mussten die ausgemergelten Menschen schleppen.
Es ging weiter mit dem Straßenbaukommando. Die Straße zum Tunnel musste schweren LKWs gewachsen sein. Letztendlich mussten sie schwere Werkzeugmaschinen und Kisten mit Motorenteilen zum Tunnel bringen (und bald darauf wieder abtransportieren). Hierzu gab es eine Truppe mit Italienischen Militärinternierten. Diese Männer konnten sich schon ohne Belastung kaum auf den Beinen halten. Sie mussten den Untergrund für die Straße herrichten und glätten. Das bedeutete Unmengen an Steinen und Kies herbeizuschleppen und zu ebnen.
Der Kapo, ein Häftling aus dem KZ Majdanek, hatte dort von russischen Häftlingen eine Arbeitsmethode gelernt, bei der man sich einigermaßen schonen konnte: Immer in Bewegung bleiben, immer so tun als werde etwas getan aber mit gebremstem Tempo. Die Häftlinge waren durch ihren schlechten Zustand gezwungen, jede mögliche Kalorie einzusparen. So konnten sie den Tod hinauszögern. Wenn sie Glück hatten, bis zur Befreiung. (Dieser Kapo kam aus dem polnischen Widerstand.)
Es ging weiter beim Ausbau des Tunnels.
Der Tunnel lag voll mit Schotter auf dem Boden, der noch vom Bahnausbau liegen geblieben war. Dieser musste auf 1,6 km aus dem Tunnel entfernt werden. Im Tunnel wurde ein zusätzlicher Seitenausgang gebrochen. Ohne Luftzufuhr versagten die Maschinen (bei den Menschen war das egal.). Der Boden musste geglättet und einer Betonschicht versehen werden. Dann kam eine Ablaufrinne für das Wasser aus dem Berg hinzu.
Die Wände mussten auf 1,6 km begradigt und verkleidet werden.
Abdeckung des Tunnels von innen:
Um den Tunnel, der für die Produktion ausgebaut werden sollte, gegen Wasser aus dem Berg zu schützen, musste eine Abdeckung über die 1,6 km gebaut werden. Es musste ein Holzgerüst zurecht gesägt, auf dem Rücken in den Tunnel geschleppt und aufgebaut werden. Auf dieses Gerüst wurden Platten genagelt, an der Seite links und rechts eine Ablaufrinne gebaut. Etienne Kotz, ein Zivilarbeiter aus einer Mühlhausener Firma, bekam 70 Häftlinge für diese Arbeit. Er war noch Lehrling und ihm war es peinlich, dass er Männer befehligen musste, die sein Vater sein könnten. Die SS zwang ihn jedoch dazu. Er versuchte sein Möglichstes, die Leute zu schonen.
Innenausbau:
In den Tunnel wurden mit Ziegelsteinen Kammern eingebaut für sanitäre Anlagen, für Meisterbüros usw. Pausenräume für die Häftlinge gab es nicht. Für die Maschinen mussten Fundamente gegossen werden.
Elektroinstallation:
Die Energie für die Maschinen und die Beleuchtung musste ebenfalls vom Bahnhof her bis in den Tunnel gelegt werden.
Entlüftung:
Diese war notwendig, damit die Maschinen nicht überhitzten. An die Häftlinge wurden daran zuletzt gedacht. Die Vorarbeiter und Meister konnten regelmäßig an die frische Luft. Die Häftlinge verbrachten, sowohl für die Zeit des Ausbaus wie auch später während der Produktion in zweimal 12 Schichten im Tunnel.
„ARBEITSJUDEN“ IM TUNNEL
Die jüdischen Häftlinge, die aus Reichshof/Rzeszòw kamen, wurden nach der Ankunft im Lager in zwei 12-Stundenschichten eingeteilt. Eine für tags, eine für nachts.
Salton:
„Ein paar schwache elektrische Lichter hingen in der Dunkelheit. Die Wände des Tunnels waren rau und nass. Die Luft war abgestanden und schimmlig und verschlechterte sich je weiter wir in den Tunnel vordrangen.
Nach einer halben Meile wurde die Beleuchtung plötzlich besser. Eine Gruppe von Zivilisten stand an einer Reihe von Drehmaschinen und Standbohrmaschinen. Auf Befragen erzählte ich dem Aufseher, dass ich Dreh- und Standbohrmaschinen bedient hatte. Wir gingen tiefer in den Tunnel, an langen Reihen von Maschinen vorbei. Nach einer weiteren Meile hielt uns der Deutsche bei zwei großen komplizierten Standbohrmaschinen an. Er sagte: “Hier machen wir die wichtigste Arbeit. Die Hauptflugzeugmotorblöcke werden an diesen Maschinen gebohrt, poliert und nachgebohrt.“
Zeitvorgabe waren weniger als neun Stunden (vermutlich pro Motorblock). Salton kannte die Arbeiten aus Reichshof (Rzeszów) und kam zum Ergebnis, dass die Vorgabezeiten erreicht werden können. Problem waren die langen Arbeitszeiten in dem unzureichend entlüfteten Tunnel. Die deutschen Vorarbeiter konnten immer wieder ins Freie gehen, die Häftlinge mussten die ganzen 12 Stunden am Arbeitsplatz durchhalten.
Die vorhandene Entlüftung diente dazu, das Überhitzen der Maschinen zu vermeiden, jedoch nicht dazu, die Arbeitsbedingungen zu erleichtern. Das und die unzureichende Ernährung brachte die Häftlinge an den Rand der totalen Erschöpfung. Heinz Rosenberg berichtet, dass sie am Ende der Schicht oft so erschöpft waren, dass sie nicht mehr in der Lage waren zu essen. Sie konnten sich nur noch auf ihre Lagerstätte legen und schlafen.
Anmerkung: Die Vorgabezeit von unter 9 Stunden die Salton nennt, ist machbar. Allerdings ist sie für 8-Stundenschicht anzulegen, und zwar mit erträglichen Arbeitsbedingungen. 12 Stunden bedeuten 50 % mehr Arbeitszeit. Unter den vorhandenen Arbeitsbedingungen und dem schlechten körperlichen Zustand der Häftlinge ist die Arbeit nicht lange durchzuhalten. Sie ist auf Dauer mörderisch und passt zu dem Ziel der Nazis: Mord durch Arbeit.
(Kommentar: Hans-Peter Goergens)
Die Produktionszeit im Tunnel dauerte jedoch nicht sehr lange. Als die Front näherkam, wurden die Maschinen abgebaut, die sog. Arbeitsjuden wurden über Colmar ins KZ Sachsenhausen (Oranienburg) verfrachtet. Das war jedoch nur eine Durchgangsstation. Von dort kamen sie ins KZ Neuengamme, von da in weitere KZs.
Arbeitsverweigerung, Sabotage, Widerstand:
„Wir haben die Arbeit verweigert, wo wir konnten, wir haben auch Sabotage gemacht, wo wir konnten. Der einzige Sabotageakt, den ich kenne, ist ein Kurzschluss der provoziert, aber als Unfall gewertet wurde. Beim Material schon, es wurde entweder zu viel oder zu wenig verarbeitet, das haben wir gemacht. Wir konnten langsam machen, das war selbstverständlich. Der Oberkapo sorgte über die Unterkapos dafür, dass auf der ganzen Baustelle langsam gearbeitet wurde. Natürlich, wenn eine Kontrolle kam von Leuten, die wir nicht kannten, wurde natürlich gearbeitet. Oft waren die Kapos bloß da, um aufzupassen, dass im richtigen Moment gearbeitet wurde. Das war in Urbès bestimmt ein Vorteil.“
Verhältnis deutsche und elsässische Vorarbeiter bzw. Facharbeiter:
Die Elsässer behandelten die Häftlinge in der Regel als Kameraden, brachten auch gelegentlich heimlich Nahrungsmittel für sie mit. Auf jeden Fall schikanierten sie keine Häftlinge. Bei den Deutschen bemerkten die Häftlinge schnell, wer ein fanatischer Nazi war oder nicht.
Vermutlich wurde ihnen zur Vorbereitung auf Arbeit mit Häftlingen eingebläut, dass die Verbrecher und Volksfeinde waren. „Die an den Maschinen arbeitenden deutschen Zivilisten rekrutierten sich im allgemeinen aus fanatischen Nazis. Und wenn sich ein Deutscher fand, dann war er von Hitler-Anhängern so umstellt, dass er fürchtete, einige Worte mit den Polen zu wechseln.“ DB S. 583
Zacheusz Pawlak, einige Zeit als Sanitäter in der Krankenstube, erinnert sich an zahlreiche Arbeitsunfälle der Häftlinge, die mit Sicherheit auf die mangelhafte Einarbeitung zurückzuführen waren.
HAFTBEDINGUNGEN, HUNGER, ERNÄHRUNG
HAFTBEDINGUNGEN
Der Appell
Der tägliche Appell morgens und abends war schon für sich eine Qual. Nach dem zu frühen Aufstehen, der hastigen Verrichtung der Notdurft, einem mangelhaften „Frühstück“ mussten die Häftlinge in Reih und Glied nach Größe ausgerichtet stillstehen. Kein Laut durfte zu hören, keine Bewegung zu beobachten sein. Die „Kleidung“ musste „tadellos“ sein. Wenn dem Kommandanten etwas nicht gefiel, wurde der Apell verlängert, das Zählen wiederholt, gleichgültig wie spät es wurde und ob Häftlinge ohnmächtig wurden. Qualvoll war auch, den langen Tiraden des Kommandanten zuhören zu müssen. Häftlinge, die während der Arbeit starben oder verletzt wurden, mussten von ihren Kameraden zum Appellplatz getragen werden.
Die Kleidung
Als Kleidung hatten die Häftlinge die übliche gestreifte Kluft wie in allen Konzentrationslagern. Sie bestand aus Hose, Jacke und einer Mütze. Dazu die unmöglichen Holzschuhe oder abgetragene Schuhe von verstorbenen Häftlingen.
Wladislaw Bartoszewski beschreibt das so:
„Gekleidet sind sie (die Häftlinge) in einheitlichen Anzügen aus Zellwolle, grau-dunkelblau gestreift. Diese grässliche Zellwolle! Wenn sie nass wird, wird sie steif wie ein Brett. Im Winter gibt sie, obwohl sie dick ist, keinerlei Wärme. Die Kleidung wanderte von einem Häftling zum anderen; von den Toten zu den Lebenden. Die Aufseher sind froh, jede Gelegenheit zu nutzen, um die Häftlinge zu ärgern, indem sie ihnen bösartig falsche Größen zuteilen, eine große Jacke und Hose an Kleinwüchsige geben und kleine Sachen für Großgewachsene. Dadurch sehen viele Häftlinge auf eine tragische Weise grotesk aus.“
Die Kleidung, wie die gesamte Behandlung KZ-Häftlingen diente und verstärkte die Entpersönlichung der Menschen. Ihm wurde der Namen genommen. Er wurde zu einer Nummer degradiert. Dazu hatte schon zu Beginn der Haft die gestreifte Kleidung, die Rasur am ganzen Körper gedient. So sollte von Beginn an die Persönlichkeit von Beginn an die gesamte Haft hindurch gebrochen werden. Dazu kamen lange und harte Arbeitszeiten, ständiges Antreiben. Alles musste im Laufschritt geschehen damit die Häftlinge nicht zur Besinnung kamen.
Krankheit – Tod – Todesort
Wie wir sehen, sterben in Urbès nur die Hingerichteten. Arno Huth (Gedenkstätte Neckarelz) konnte dankenswerterweise aus Bad Arolsen neue Informationen holen. Viele Häftlinge werden krank, kommen in das Krankenrevier nach Natzweiler werden gesund oder sterben dort oder kommen in weitere Lager und sterben oder überleben dort. Als es sichtlich dem Kriegsende zuging, wurden regelrechte Sterbelager eingerichtet. Oft wurden die dazu gehörenden Massengengräber erst nach dem Krieg entdeckt. Dass ein Häftling die KZ-Haft überlebte, sagte noch nichts über seine gesundheitliche Zukunft aus. Viele starben nach kurzer Zeit in der Freiheit, andere waren lebenslänglich schwerbehindert. Die meisten waren in ihrer beruflichen Entwicklung stark behindert und dementsprechend langearbeitslos. Die Folge waren niedrige Renten und Altersarmut. In Frankreich wurden die überlebenden französischen Häftlinge aus dem KZ Mittelbau-Dora langfristig medizinisch betreut. Innerhalb eines Jahres nach der Befreiung starben 50 % der ehemaligen Häftlinge.
HUNGER – ERNÄHRUNG
VERNICHTUNG DURCH ARBEIT
FLUCHT DER HÄFTLINGE AUS DEM LAGER
Von Flucht, Freiheit und Ende der Qualen träumte jeder Häftling, sofern er noch Kraft genug hatte. Das Problem war, die meisten hatten keine Orientierung. Wohin sollten sie sich wenden? Wie würde sich die Bevölkerung verhalten? Konnten Sie sich verständigen?
Drei sowjetische Häftlinge, Kriegsgefangene, wagten es: Alexej Fomine, Sergej Michailow und Nikolaj Tschketwekow am 18. April 1944. Sie flüchteten durch ein Kanalisationsrohr um in den nahen Wald zu entkommen. Nikolay Tschketwekow schaffte es nicht. Er wurde von einer Patrouille erschossen, die beiden anderen kamen durch. Sie kletterten den Berghang hoch Richtung Storckenson bis zum Pass von Rimbach und dann bis Mollau. Ihr Glück war, dass an diesem Tag Emile Spetz, der ehemalige Bürgermeister von Strockenson mit seinem Freund Charles Neff gerade dort spazieren ging. Dort trafen sie zwei Männer in gestreifter Kluft.
Beide waren ziemlich angeschlagen, Fomine hatte gar durch das kalte Wasser im Kanal eine Lungenentzündung. Die beiden Elsässer führten sie zu Maquisards, die in der Region waren. Denen gelang es, die beiden im Bauernhof der Familie Henri Philippe im Weiler „Les Evaudois“ bei Servance unterzubringen. Die Familie gehörte zur lokalen Widerstandsgruppe. Dr. Mathieu, Krankenpfleger des lokalen Maquis versorgte Fomine. Suzanne Philippe, die Nichte des Ehepaars, pflegte Fomine gesund.
Die beiden erholten sich in den nächsten drei Wochen und schlossen sich dem Maquis an, zuerst dem Maquis „Le Poteau“, dann dem des „Peut-Haut“.
Die beiden hatten Kampferfahrung, die den Maquis abging, waren also eine gute Verstärkung. Nach der Befreiung ging Alexej Fomine zum 151. Infanterieregiment der 1. Franz. Armee und kämpfte gegen die Nazis. Er besuchte am 14. Juli 1964 die Familie Philipps in St. Raphael an der Franz. Riviera. Vom 15. Bis 18. September 1989 besuchte er Urbès anlässlich einer Gedenkfeier für die Häftlinge. Am 18. September 1989 traf er dort Ernest Gillen. Dabei war auch Robert Curien, Überlebender der Erschießung vom 4. Oktober 1944 am Steingraben.
Am 1. Januar 2003 verstarb er im Alter von 83 Jahren.
Mark Spoerer zum Thema Flucht:
Ich kann mich erinnern, in den ersten drei Wochen sind zwei Mal Gruppen von Russen ausgebrochen. Da wurde in den Bergen nach ihnen gesucht. Wir haben offiziell nichts erfahren. Aber die Soldaten haben uns das dann erzählt: „Das ist eine Sauerei, jede Nacht müssen wir jetzt Überstunden machen. Wir müssen nicht bloß hier stehen, wir müssen das auch nachts machen. Das ist schrecklich lange.“
Aber einer sagte: „Ich würde gerne noch 14 Tage so laufen, wenn ich bloß wüsste, dass die niemand findet.“„Bei unserer Flucht durch die Kanalisation, war unsere große Sorge am Ende ein Schutzgitter vorzufinden. Wir hatten nur eine Eisenstange als Hilfsmittel […] Aber das Glück stand auf unserer Seite. Kein Gitter und die Wache, die nur 20 Meter weit weg war, war betrunken und hat nichts gehört.“ Alexej Fomin, Aussage bei seinem ersten Besuch am Tunnel von Urbès am 18. September 1989.“
„Bei unserer Flucht durch die Kanalisation, war unsere große Sorge am Ende ein Schutzgitter vorzufinden. Wir hatten nur eine Eisenstange als Hilfsmittel […] Aber das Glück stand auf unserer Seite. Kein Gitter und die Wache, die nur 20 Meter weit weg war, war betrunken und hat nichts gehört.“
Alexej Fomin, Aussage bei seinem ersten Besuch am Tunnel von Urbès am 18. September 1989
„Wegen der Flucht der Russen erhielt der Kommandant Brendler den Befehl der Leitung, das ganze Lager zu bestrafen. Brendler organisierte die gewaltigste Prügelstrafaktion, die ich je erlebt habe: Jeder der 800 bis 1000 Russen erhielt 10 Stockhiebe auf das Hinterteil. Die Strafmaßnahme dauerte mehrere Tage […|“
Von Ernest Gillen, Luxemburger, deportiert nach Natzweiler, Urbès, Neckarelz, Heppenheim, Dachau.
Todesurteil für vier Häftlinge
Am 20.Juni 1944 versuchten vier russische Häftlinge zu fliehen. Es war ihnen nicht gelungen. Am Eingang des Tunnels wurde ein Galgen errichte. Die vier Häftlinge wurden nebeneinander hingerichtet. Dabei mussten alle Kameraden zusehen. Es handelte sich um folgende Häftlinge:
- Semion Muradow
- Wlodizimierz Fiodorow
- Gregor Klikowiec
- Fedor Wotoschin
Am 14. April wurde ein geflüchteter Häftling wieder gefasst. Er war durch die Kanalisation geflohen. Von ihm wurde verlangt, seine Flucht zu wiederholen. Als die Demonstration gelungen war, wurde er erschossen. Am 10. September wurde ein jüdischer Häftling beim Fluchtversuch erschossen. Am 15. September 1944 versteckte sich ein jüdischer Häftling in Verpackung, die aus dem Lager gebracht wurde. Außerhalb des Lagers entdeckte ihn der Ortsgeistliche und brachte ihn ins Lager zurück. Ihm ist dann nichts passiert.
DAS AUSSENLAGER VON URBÈS: FLUCHT VON 2 RUSSISCHEN HÄFTLINGEN, ALEXEJ FOMINE UND SERGEJ MICHAILOW, AM 18. APRIL 1944. IHR ENGAGEMENT IM MAQUIS VON „LE POTEAU“ UND „LE PEUT-HAUT“.
Einige biographische Angaben:
Alexej Fomine wurde 1920 geboren und er kaum 24 Jahre alt, als er sich mit Sergej Michailow im 3. Transport von 2000 russischen Kriegsgefangenen befand; die Gefangenen wurden in 2 Gruppen geteilt, eine musste sich nach Sainte- Marie-aux-Mines begeben, die andere nach Urbis.
Alexej Fomine war Leutnant in der Roten Armee, als er gefangen genommen wurde; er kam aus Olonets in der Gegend von Sankt Petersburg und war dort als Lehrer tätig. Er ist am 1. Januar 2003 gestorben.
Sergej Michailow kam aus Weiβrussland; er starb 1979. Er ist nie mehr ins Elsass zurückgekommen.
Kontext ihrer Flucht, am 18. April 1944:
Zuerst zu fünft, dann zu viert und schlieβlich nur noch zu dritt, gelang es Fomine und Michailow durch ein dickes Kanalisationsrohr zu fliehen und den nahen Wald zu gewinnen. Der dritte Flüchtling, Nikolaj Tschetwekow wurde von einer Patrouille erschossen; schwer verletzt starb er am folgenden Tag im Lager selbst. Die SS Soldaten feierten mit etwas Vorsprung Hitlers Geburtstag und waren schon ziemlich betrunken, ihre Bewachung war umso lockerer; für die beiden Häftlinge war es wie eine Gabe des Himmels, um abzuhauen!
Bei seinem Besuch im Tunnel von Urbis, am 18. September 1989, erklärte Alexej Fomine:
„Unsere gröβte Furcht war, am Ausgang gegen ein Gitter zu stoβen. Wir besaβen ja nur eine Eisenstange als Werkzeug (…) Jedoch hatten wir sehr viel Glück. Kein Schutzgitter und 20m von uns entfernt ein betrunkener Wachposten, der überhaupt nichts gehört hatte“.
(Zeitungsartikel aus l’Alsace, vom 20. September 1989).
Ablauf ihres gefährlichen Wegs zur Freiheit:
Die beiden Flüchtlinge bestiegen mühsam den Berghang von Storckensohn, kletterten bis zum Pass von Rimbach und gelangten schlieβlich in das kleine Tal von Mollau. Glücklicher Zufall: an jenem Tag gingen 2 Männer, Emile Spetz, ehemaliger Bürgermeister von Storckensohn und Besitzer des Hotels zur Krone, das von den Nazis als Unterkunft beschlagnahmt wurde, und sein Freund, Charles Neff gemütlich spazieren, als sie 2 Männern mit gestreiftem Häftlingskleid begegneten. Der eine schien sehr krank zu sein: es war nämlich Alexej Fomine, der sich eine Lungenentzündung, während er durch das eiskalte Wasser der Kanalisation lief, zugezogen hatte. Die beiden Spaziergänger hatten Mitleid mit den Flüchtigen und vertrauten sie Fluchthelfern oder Maquisards der Gegend an. Diese führten sie jenseits der Vogesen und brachten sie zu Maquisards des Séchenat, die ihrerseits bemüht waren, den beiden Flüchtlingen eine Unterkunft auf einem Bauernhof zu finden. Schlieβlich wurden sie im Bauernhof der Familie Henri Philippe, im Weiler „Les Evaudois“, bei Servance versteckt. Alexej Fomine wurde vom Arzt, Doktor Mathieu, der auch als Krankenpfleger des lokalen Maquis tätig war, gepflegt. Auf diesem Bauernhof lebte ebenfalls Suzanne Philippe, die von ihrem Onkel und ihrer Tante groβgezogen wurde; sie kümmerte sich um den kranken Fomine. Eigentlich gehörte diese ganze Familie zur lokalen Widerstandsgruppe.
Recht herzlichen Dank an Frau Denise Arnold und an Herrn Gilbert Meny, Kurator des Serret Museums, Sankt-Amarin für die geliehenen Dokumente.
Wiedertreffen mit Frau Suzanne Philippe, verheiratet Martin, in Villersexel, Haute-Saône, dank des Beharrens und des Glücks von Herrn Pierre Maurer der Widerstandsvereinigung der Vogesen – C.V.R- von Bussang. 20. September 1989.
Alexej Fomine (3. links) in Begleitung von ehemaligen Widerstandskämpfern aus Bussang. Frau Suzanne Philippe-Martin, erste Frau links.
So wurden die beiden Flüchtlinge während 3 Wochen in einer Heunische versteckt und so konnte Fomine ruhig genesen und wieder zu Kräften kommen. Die beiden schlossen sich dann dem Maquis an, zuerst dem Maquis „Le Poteau“, dann demjenigen des „Peut-Haut“. Ein ehemaliger Maquisard aus den Vogesen erinnert sich an die beiden Russen und berichtet:
„Als der Maquis angegriffen wurde, hätte man sehen sollen, wie die beiden mutig kämpften. Die beiden hatten eine Erfahrung vom Krieg, die wir gar nicht besaβen (…)“.
Quelle : Zeitungsartikel aus L’Alsace, « Alexej Fomine retrouve celle qui l’avait sauvé à Servance » von Herrn Laxenaire, 1990).
Nach der Befreiung, engagierte sich Alexej Fomine in der 1. Französischen Armee, 151. Infanterie Regiment und kämpfte gegen die Nazis.
Rückkehr zum Ort seiner Inhaftierung im Elsass und Wiedertreffen mit der Familie Philippe, 45 Jahre später:
Erste Rückkehr von Alexej Fomine nach Frankreich, am 14. Juli 1964, aber in Saint-Raphaël (Französische Riviera). Erste Rückkehr zum Ort seiner Inhaftierung im Lager von Urbis, vom 15. bis 18. September 1989, im Rahmen einer Gedenkfeier an die ehemaligen Häftlinge vom KL- Natzweiler-Struthof.
Am 18. September 1989 konnte Alexej Fomine den Ort seiner Haft 1944 besichtigen, in Anwesenheit der Delegation ehemaliger Luxemburgischer Häftlinge, unter ihnen Ernest Gillen. Anwesend waren auch Vertreter der Gemeinde Urbis, des Kantonal Komitees des Souvenir Français, damals geleitet von Herrn Charles Arnold, sowie Herr Robert Curien, Überlebender der Erschieβung vom 4. Oktober 1944 am Steingraben bei Urbis
Alexej Fomine starb am 1. Januar 2003, im Alter von 83 Jahren.
Quellen :
Besten Dank an Frau Denise Arnold und an Herrn Gilbert Meny, Kurator des Museums Serret in Sankt Amarin, für alle Dokumente und Fotos, die sie uns geliehen haben.
– Zeitungsartikel aus l’Alsace, 17. September 1989.
– Zeitungsartikel aus L’Alsace, 20. September 1989.
– Zeitungsartikel aus L’Alsace von Herrn Laxenaire, 1990.
ZEUGENAUSSAGEN POLNISCHER HÄFTLINGE AUS DEM LAGER VON URBÈS

Zacheusz Pawlak
Autobiographie und Zeugenaussage « Ich habe überlebt… ein Häftling berichtet über Majdanek“, Hamburg, 1979. Pawlak gehörte zur polnischen Widerstandsbewegung. Als ihn die Gestapo in der Nacht vom 25.- 26. November 1941 verhaften wollte, gelang es ihm zu fliehen. Die Gestapo nahm aber seine 2 Brüder, Jan und Tadeusz, als Geisel. Pawlak war von dieser abscheulichen Art und Weise zu handeln so entrüstet, dass er sich von selbst den Nazis in Radom am 6. September 1942 übergab. In Radom wurde er 4 Monate lang eingesperrt, oft verhört und sogar dabei gefoltert. Erschöpft und auβer Kraft, wollte er Selbstmord begehen, jedoch gelang es seinen Mitgefangenen, ihn davon zurückzuhalten. Trotz der Folterung und all der Qualen, die er erleiden musste, schwieg er und verriet nie einen einzigen seiner Kollegen vom polnischen Widerstand. Am 8. Januar 1943, wurde er ins KL Lublin-Majdanek verschleppt, obwohl er schwer erkrankt und wegen all der Misshandlungen völlig erschöpft war. Trotz der schrecklichen Lebensverhältnisse im KL von Lublin/Majdanek konnten Pawlaks Wunden heilen und es gelang ihm sogar, wieder Kräfte zu schöpfen, um überleben zu können.
Ihm fiel die lästige Latrinenarbeit zu und sein Kommando trug den anschaulichen Namen « Scheiβkommando » – diese Arbeit war zwar lästig, aber die Häftlinge konnten sich nach ihrer Arbeit in die Küche begeben, um das Geschirr zu spülen. Ab und zu bekamen sie sogar Küchenreste zu essen! Das war ein Luxus im Vergleich zu Latrinen leeren und Jauchewagen aus dem Lager schieben! Später konnte er im Revier oder Block für Kranke arbeiten, dank der Hilfe und der Unterstützung von Doktor Romuald Sztaba, polnischem Häftling wie er. In seiner Autobiographie in Form von Zeugenaussage über seinen Lebensabschnitt in verschiedenen nazistischen Lagern, erwähnt Zacheusz Pawlak auch seine Haftperiode im Lager von Urbis.
Seine Überstellung ins Auβenlager von Urbis:
Nach all den Gräueltaten, die er im KL-Lublin/Majdanek hatte erleiden müssen, gehörte er zur Selektion in Richtung eines unbekannten Lagers. In der Tat befand er sich mitunter den 500 Häftlingen, die im April 1944 vom KL-Lublin/Majdanek in Richtung Wesserling-Urbis abtransportiert wurden. Während des Transports in Güterwagen versuchte eine Gruppe von 5 Häftlingen, die eine kleine Säge versteckt hatten, zu fliehen. Zu ihrem Unglück wurden sie wieder gefangen genommen und von SS-Leuten erschossen. Pawlaks bester Freund, Stefan Szpruch, wurde schwer verwundet. Pawlak selbst wurde verschont, da die Pistole des SS-offiziers versagte. Die Leichen der Erschossenen wurden in einen Waggon geladen als Beispiel und Warnung für alle anderen Häftlinge. Pawlak berichtet über die Ankunft im Bahnhof von Wesserling:
„Am Nachmittag [erreichten wir das Ziel]. Der Zug hielt in Wesserling im Elsass an (…) Die Deutschen bereiteten uns zum Abmarsch vor. Obwohl ich mich in den nicht passenden Holzschuhen kaum auf den Beinen halten konnte, ging ich gemeinsam mit den anderen in der Kolonne in Richtung der Berge eine lange, gewundene Landstraße entlang, deren Rand abschnittsweise Nussbäume säumten. Nachdem wir etwa 6 km auf dieser herrlichen Straße in der Ebene gegangen waren, sahen wir Baracken, die mit Stacheldraht eingezäunt waren. Drei der Baracken waren für Häftlinge bestimmt und eine außerhalb des Drahtzauns für die Wachmannschaft und die Kommandantur.
Auf einer etwa 1,5 km vom Lager entfernten Anhöhe sah man den schwarzen Austritt eines Tunnels. Davor erhob sich in Richtung der Baracken eine Aufschüttung frisch gebrochenen Gesteins, die sich bis zu einer hohen und noch nicht vollendeten Brücke über eine tiefe Schlucht, in der ein reißender Gebirgsbach floss, hinzog.
Man führte uns in das Lager, in dem sich etwa 750 Häftlinge befanden. Wir wurden in Baracke 3 untergebracht. Auf dem Lagerplatz bemerkten wir Fundamente von vielen ausgebrannten Baracken. Die von Häftlingen bewohnten waren auf den alten Fundamenten errichtet. Wir erfuhren, dass die Franzosen bereits seit dem Jahre 1935 einen Tunnel durch die Vogesen getrieben hatten. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist man etwa 7 km vorangekommen (…) Gleich hinter dem Lager, hinter der Geländeerhebung, befanden sich die Baracken, die für zivile Arbeiter bestimmt waren“.
Quelle: „Das Natzweiler Aussenlager Wesserling-Urbis, als A-Projekt des Jägerstabs“ Arno Huth, Gedenkstätte Neckarelz.
Seine Zeugenaussage über die Arbeits- und Überlebensbedingungen im Lager von Urbis ist detailliert und wertvoll. Rührend erzählt er auch von der Freigebigkeit der lokalen Bevölkerung (Siehe, Texte P1 und P2). Da er Deutsch sprechen konnte, wollten ihn die SS Leute zum Kapo von 50 italienischen Häftlingen ernennen. Dieses Kommando hatte die Aufgabe, eine Schotterstraβe zu bauen. Jedoch war Pawlak diese Funktion zuwider und es gelang ihm, den
Lagerältesten, Anton Koehler, von allen Toni genannt, zu „kaufen“ und eine Arbeit beim Bahnhofskommando in Wessserling zu erhalten. Während seiner Haft in Urbis litt Pawlak öfters an Nierensteinkoliken, aber auch Gelbsucht und sogar an Typhus und er wurde immer schwächer. Dank der Solidarität unter polnischen Häftlingen, hielt er jedoch durch und im Juli 1944 kam er in ein neues Kommando, verantwortlich für die Parkpflege des Schlosses in Wesserling. Zu seinen Arbeitskollegen zählten polnische Kameraden wie Stanislaw Figura und Bolek Marchewka.
Im Schloss von Wesserling hatte nämlich die Waffen-SS einen Teil des Gebäudes in « Genesungskompanie » umgewandelt, das heisst in einen Ort, wo deutsche Verwundete oder kranke Soldaten genesen konnten. Als sich die Alliierten später dem Elsass näherten, diente daher das Schloss auch als Unterkunft für einen Stab des Frontabschnitts.
Deswegen ist es interessant, bei Pawlaks Bericht über das Schloss zu verweilen. Inmitten des Schlossparks lebten einige Arbeiterfamilien, die in den verschiedenen Textilfabriken ihr Brot verdienten; sie wohnten in kleinen elsässischen Fachwerkhäusern, die Pawlak sehr hübsch fand. Auf dem Balkon eines solchen Häuschens befand sich ein junges Mädchen von etwa 16 Jahren, das stundenlang und mit einem freundlichen Lächeln den Häftlingen beim Arbeiten zuschaute. Es hieβ Valentine. Einige Tage später, kam Valentines achtjähriger Bruder vorbei. Er trug einen geflochtenen Korb, in welchem er eine Flasche Rotwein und ein in Leinen gewickeltes Paket hatte. Mit zitternden Händen holte er den Wein und das Bündel heraus und nachdem er sich vergewissert hatte, dass kein SS-Wachmann gerade in Sicht war, händigte er den Häftlingen Wein, Butterbrote und Obst aus. Von diesem Tag an erhielt Zacheusz Pawlak und seine Gefährten regelmäβig etwas zu essen und sogar Leckerbissen, für welche sie natürlich sehr dankbar waren. Valentines kleiner Bruder hatte die Erlaubnis von den örtlichen SS-Leuten erhalten, im Schlosspark frei hin und her zu gehen, um Küchenreste für seine Kaninchen zu holen.
Eines Tages musste Pawlak mit seinem Freund Bolek Marchewka in Anwesenheit der Wachleute groβe versiegelte Metallkisten in den Keller des Schlosses tragen. Eine der Kisten war beschädigt worden und so gelang es Pawlak, ein streng geheimes Dokument in die Hände zu bekommen. Es handelte sich um einen „Generalplan für die Umsiedlung der Slawen“. Dieses Dokument enthielt auch zahlreiche Landkarten und groβe Pfeiler markierten die genauen
Umsiedlungs- und Ansiedlungsgebiete. Anstelle der Aussiedler sollten Volksdeutsche aus der UDSSR und dem besetzten Baltikum angesiedelt werden. Er versteckte dieses Dokument in die Wand der Baracke, wo er untergebracht war.
Da Pawlak ständig unter Hunger litt, nahm er auch heimliche kleine Näharbeiten gegen ein bisschen Nahrung an. Es gelang ihm auch mit dem persischen Arzt, Aschur Barhad, in der neu erbauten Krankenbaracke oder Revier zu arbeiten; die schlimmsten Fälle wurden nach Natzweiler-Struthof abtransportiert und keiner von ihnen kam jemals zurück! Etwa ab dem 10. September 1944 begann die Evakuierung und Auflösung des Lagers von Urbis.
Der erste Häftlingstransport in Güterwagen ging von Wesserling via Colmar, Straβburg, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg nach Neckarelz.
Wie Ernest Gillen und viele andere Häftlinge aus dem Lager von Urbis, kannte Zacheusz Pawlak einerseits die geheime Freude des nazistischen Zusammenbruchs und des Vormarsches der Alliierten, aber andererseits auch die ständige Angst vor einem Kollektivmord aller Häftlinge, kurz bevor die Sieger sie entdecken würden. Wie zahlreiche andere Häftlinge aus Urbis, musste er nach der Evakuierung und Auflösung der Lager in Neckarelz, Bad Rappenau … mehrere Todesmärsche miterleben, sei es der Todesmarsch nach Dachau, nach München-Riem oder nach Bad-Tölz. Am 2. Mai 1945 wurde er schlieβlich von amerikanischen Truppen befreit.
Quellen:
– « Polnische Zwangsarbeiter im Elzmündungsraum. KZ-Häftlinge und Arbeitskräfte in Landwirtschaft und Industrie. Polen Dokumentation der KZ Gedenkstätte Neckarelz“, 2008, Arno Huth und Georg Fischer (Seiten 117 bis 126).
– „Das Natzweiler Auβenlager Wesserling als A- Projekt des Jägerstabes“, Arno Huth, Gedenkstätte Neckarelz.
Jozef Moranski
Er wurde am 11. Februar 1924 in Kraminkawilka geboren. 1941 wurde er wegen Sabotage -Verdacht verhaftet. Als Schlosser arbeitete er in einer Werkstatt, in welcher Lokomotiven repariert wurden. Jedoch war eine davon defekt, weil Sand im Getriebe war! Zuerst kam er ins Sammelgefängnis von Tarnow, wo er öfter verhört und sogar gefoltert wurde. Etwas später wurde er ins KL-Dachau verlagert und danach ins Lager von Urbis. Jozef Moranski konnte sich wenig über seine Haft in Urbis erinnern, im Vergleich zu seinen Aussagen über seine Haft in anderen Lagern. Sobald er ins Lager von Dachau überstellt wurde, kam Moranski anfangs zur Quarantäne in den „Todesblock 11“, der sich in einem Keller befand und mit einer Todeswand versehen war, wo die zu Tode Verurteilten in eine Reihe stehen mussten, bevor sie erschossen wurden. Für ihn war dieses Erlebnis ein furchtbares Trauma. Dann gehörte Moranski zum «Holzkopfkommando», das etwa 110 Häftlinge zählte. Mittels einer Axt mussten sie nicht nur Holz für die Küche machen, sondern auch Holzbalken, mit denen Gräben verschalt wurden, anfertigen. Jeder Kapo hatte eine Schaufel und mit dem Holzstiel schlugen sie auf Häftlinge zu, wenn sie nicht schnell genug arbeiteten, bis sie sich nicht mehr rührten.
Einige Zeit später erkrankte Moranski an Flecktyphus. Er sah bald wie ein „Muselmann“ aus; „Muselmänner“ wurden schwer kranke Häftlinge genannt, die praktisch schon für tot erklärt waren und die nur noch aus Haut und Knochen bestanden! Moranski wog kaum noch 38 Kilo und war beinahe blind! Ein jüdischer Arzt hatte Mitleid mit ihm und tat sein Bestes, um ihn zu retten.
Seine Überstellung in das Auβenlager von Urbis:
Anfangs April 1944 wurden 550 Häftlinge, unter ihnen Jozef Moranski, selektioniert und abtransportiert; das Ziel war jedoch unbekannt. Am 6. Mai 44 kam der Transport in Güterwagen im Bahnhof von Wesserling an. Im Lager von Urbis trug er die Nummer 16624, diejenige vom KL-Natzweiler. Moranski berichtet wenig über seine Haft im Elsass. Jedoch wusste er mit Sicherheit, dass er am 7. August 1944 nach Neckarelz überstellt wurde und dass er dort in alten Gipsstollen arbeiten musste. Er musste nämlich in Obrigheim Stollen ausbessern, sie abstützen und die Wände verstärken, damit sie den Nazis als unterirdische Werkstätten dienen konnten. Moranski erzählt eine schöne Geschichte von einer Weihnachtskrippe, die er gebastelt hatte:
Kurz vor Weihnachten fragte ihn ein elsässischer Zivilarbeiter, ob er eine Krippe basteln könnte. Moranski sagte zu, unter der Bedingung, dass der Elsässer ihm Material dafür besorgte und ihm ein Versteck finden würde, wo er ungestört an der Fertigung dieser Krippe arbeiten könnte. Der Elsässer, ein guter katholischer Mann laut Moranski, bekam seine Krippe zur rechten Zeit und als er kurz nach Weihnachten wieder ins Lager kam, brachte er eine Menge Tabak und Kartoffeln mit, die er Moranski schenkte. Dieser teilte das Geschenk mit anderen Häftlingen.
Todesmarsch nach Dachau:
Jozef Moranski war mit anderen Häftlingen in der Schule von Obrigheim untergebracht. Eines Tages hieβ es aufbrechen und zu Fuβ weggehen, in Begleitung von Wachsoldaten auf Motorrädern oder in Autos. Während dieses Todesmarsches in Richtung Dachau, litten die Häftlinge furchtbar unter Hunger, Durst und Erschöpfung. Moranski erzählt, dass einige unter ihnen so schwach waren, dass sie nicht einmal mehr ihre wertvolle Decke auf ihren Schultern tragen konnten; sie mussten sie auf dem Weg lassen!
Die Zivilbevölkerung, oft voller Mitleid mit ihnen, reichte den ausgehungerten und skelettartigen Häftlingen ein bisschen Nahrung oder Wasser zu. Ab und zu machten sie einen Halt am Rande eines Waldes; sobald die Häftlinge einen Igel oder irgendein anderes kleines Tier erblickten, stürzten sie sich darauf, töteten es und verschlangen es roh! Und ebenso ging es mit einem verendeten Pferd am Straβenrand liegend, nach einem Bombenangriff der Alliierten!
Andere Häftlinge, die zu schwach und zu krank waren, wurden einfach vor Ort gelassen; und als es hieβ weiter zu marschieren, wurden die meisten von den SSLeuten, in Autos am Ende der Kolonne, kaltblütig erschossen. Die erschöpfte Kolonne gelangte schlieβlich zu einer kleinen Bahnhofsstation, wo die Häftlinge aufgefordert wurden, in die mit dem Roten Kreuz versehenen Güterwagen zu steigen. Jedoch wurde der Transport bombardiert und bei der Ankunft in Dachau waren sie nur noch 1500 auf 2000 beim Abmarsch. Sobald die Häftlinge ins Lager kamen, zeigte ihnen ein SS- Kommandant den Schornstein des Krematoriums, aus dem eine dicke Wolke in den Himmel heraufstieg und er sagte drohend: “ Durch diesen Kamin sind schon einige tausende gegangen“! Jedoch erhofften sich die Häftlinge nur eins: ihre baldige Befreiung durch die Alliierten! Nach seiner Befreiung hatte Jozef Moranski öfters die Gelegenheit, ins KL-Dachau zurückzukehren, aber jedes Mal als freier oder befreiter Mensch und als Zeuge!
Schlussfolgerung:
Noch lange Jahre danach war Jozef Moranski böse auf die Deutschen und sein Herz war erbittert. Er gestand auch, dass er lange unter Albträumen litt und dass er lernen musste, wieder ein normales Leben zu führen. Und das brauchte Zeit.
Quelle:
« Polnische Zwangsarbeiter im Elzmündungsraum. KZ-Häftlinge und Arbeitskräfte in
Landwirtschaft und Industrie. Polen Dokumentation der KZ Gedenkstätte Neckarelz“, 2008, Arno Huth und Georg Fischer (Seite 127 bis130).
Tadeus Szwed
wurde am 22. August 1925 in Sosnowitz geboren; er starb am 1. März 1999 und wurde in Warschau begraben. Im Mai 1942 wurde er im Alter von 17 Jahren von der Gestapo verhaftet, weil er sich weigerte, im Rahmen des RADs in Deutschland zu arbeiten und weil er wegen Sabotage Akten in der Fabrik seiner Heimatstadt, wo er tätig war, verraten wurde. Seine Mitarbeiter hatten ihn ertappt, als er Sand in das Getriebe einiger Maschinen goss! Auf Befehl der Kriminalpolizei von Sosnowitz wurde er am 13. oder 15. Juni 1942 im Gefängnis nach Myslowitz eingesperrt. Dort musste er Verhör und Folterung erleiden und lange nach seiner Befreiung fiel es ihm schwer, darüber zu sprechen.
Am 3. Januar 1943 wurde er ins KL-Auschwitz verschleppt. Im Lager von Auschwitz musste er im Kommando beim Gleisbau arbeiten und wurde 2 Mal schwer verletzt. Nach heftigen Schlägen mittels eines Spaten wurde er sogar an einem Ohr taub. Dank der Unterstützung des Blockältesten konnte er ausgelesen werden, um ins Elsass deportiert zu werden. So gehörte er zum Transport von 550 Häftlingen, der am 6. Mai 1944 im Bahnhof von Wesserling eintraf, nach einer schweren und leidvollen Reise von 2 Tagen in Güterwagen.
Seine Haft im Lager von Urbis:
Tadeus Szwed wurde beim Verlegen von Eisenbahnschienen und beim Ausbau des Eisenbahngleises, das zum Tunneleingang führen sollte, beschäftigt. Die Überlebensaussichten sowie die Haftbedingungen schienen ihm etwas besser als im Lager von Auschwitz. Die Haltung der SS-Leute war weniger brutal und grausam. Dazu gab es keine morgendlichen Selektionen im Gegensatz zu Auschwitz. Das gab ihm ein bisschen mehr Mut und Hoffnung, seine Haft zu überleben.
Räumung des Lagers von Urbis und Überstellung nach Neckarelz:
Am 9. August 1944 befand sich Tadeus Szwed im Transport von 300 Häftlingen ins Auβenkommando von Neckarelz. Beim Luftangriff der Alliierten auf den Zug kamen über 100 Häftlinge ums Leben und zahlreiche waren schwer verletzt. Tadeus Szwed musste helfen, die Toten zu bergen. Der Schock war furchtbar für ihn, sodass er in Ohnmacht fiel. Seine Kameraden mussten ihn hinter einem Waggon verstecken, damit er auβer Sicht der SS war.
In Neckarelz wurde er beauftragt, in einem ehemaligen Gipsbergwerk zu arbeiten. Dort musste er enorme Gipsbrocken herausbrechen und schwere Eisenbahnschwellen schleppen, damit eine unterirdische Fabrik von DaimlerBenz eingerichtet werden konnte. Luxus für Tadeus Szwed: in Neckarelz trug er Holzschuhe und sogar einen gestreiften Mantel!
Todesmarsch nach der Räumung des Auβenlagers in Neckarelz:
Anfangs April 1945 mussten die Häftlinge, die noch “gehfähig“ waren, einen Marsch von 3 Tagen und 3 Nächten antreten, mit der ständigen Angst von den Alliierten bombardiert zu werden. Sie wurden eine kurze Strecke nach Dachau per Zug weitertransportiert, jedoch wurde dieser unterwegs angegriffen, sodass sie den Rest des Weges zu Fuβ ablegen mussten. Wie viele andere Häftlinge aus dem Lager von Urbis erlitt Tadeus Szwed einen 2. Todesmarsch, der sie zum Flughafen München-Riem führen sollte. Ende April 1945 befand er sich inmitten einer Kolonne von ausgehungerten und erschöpften Menschen irgendwo auf dem Weg in Richtung der Alpen, ohne zu wissen, wohin dieser Marsch eigentlich führte! Tadeus Szwed wurde schlieβlich am 1. Mai 1945 von amerikanischen Truppen befreit. Jedoch blieb er noch lange am Ort seiner Befreiung, wo eine deutsche Familie ihn aufgenommen, ihm Kleider angeboten und sogar eine Arbeit besorgt hatte. Mit einem anderen polnischen Überlebenden hatte er vor, sich seitens der Amerikaner zu engagieren, um gegen die Japaner zu kämpfen. Aber dieser Plan scheiterte wegen des Endes des Krieges gegen Japan.
Rückkehr nach Sosnowitz:
Tadeus Szwed kehrte in seine Heimatstadt zu seiner Familie zurück und arbeitete dort als Elektriker. In seiner ersten Ehe wurde er Vater von 2 Kindern. Wie alle Überlebenden versuchte er mit Freud und Leid, ein neues Leben aufzubauen und die Hölle der Lagerexistenz zu überwinden und zu verschmerzen. Aber er brauchte noch viele Jahre, um das Trauma seiner Lagerhaft zu überwinden. Es kam ihm öfter vor, Albträume zu haben und sich mitten in der Nacht wie ein KZ-Häftling zu benehmen! Er starb am 13. März 1999 und wurde in Warschau begraben.
Quelle:
« Polnische Zwangsarbeiter im Elzmündungsraum. KZ-Häftlinge und Arbeitskräfte in
Landwirtschaft und Industrie. Polen Dokumentation der KZ Gedenkstätte Neckarelz“, 2008, Arno Huth und Georg Fischer (Seiten 131 und 132).
LYCÉE SCHEURER-KESTNER THANN

Gymnasium Scheurer-Kestner, Thann. Klasse TES1 / 2015 – 2016 / Deutschunterricht – Marguerite Kubler.
ZWEI DENKMALE FÜR DIE RESISTANCE IN DIESER REGION AM STEINGRABEN